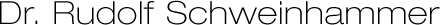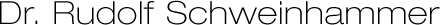PATIENTENVERFÜGUNG. Die Koalition will den erklärten Willen gelten lassen, bestimmte Therapien nicht zu erhalten. Ob sich diese Frage aber im Vorhinein klären lässt, ist fraglich.
VON ALEXANDER HOFMANN
WIEN. Grenzfragen zwischen Leben, Bewusstlosigkeit und Tod beschäftigen demnächst den Justizausschuss des Nationalrats: Das Patientenverfügungs-Gesetz soll dem Einzelnen eine Mitsprache bei einer ärztlichen Behandlung auch dann sichern, wenn er seinen Willen gerade nicht äußern kann. Der von Justizministerin Karin Gastinger und Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat ausgearbeitete Entwurf liegt als Regierungsvorlage im Parlament und steht am 23. März auf der Tagesordnung des Justizausschusses.
Jede medizinische Behandlung bedarf der Zustimmung des Betroffenen. Wird ein Eingriff ohne sie vorgenommen, macht sich der Arzt grundsätzlich - außer in Notfällen - strafbar. Ist der Patient aufgrund seines geistigen oder körperlichen Zustands nicht mehr in der Lage, sich zu äußern, so kann der gesetzliche Vertreter einwilligen. Ein vom Patienten früher geäußerter Wille sollte aber Beachtung finden. Nach geltendem Recht ist jedoch ungewiss, inwieweit eine Erklärung des Patienten, eine bestimmte Behandlung nicht zu wünschen, verbindlich bleibt, wenn der Kranke später seine Einsichts-, Urteils- oder Äußerungsfähigkeit verliert.
Das geplante Gesetz, das hier Klarheit schaffen soll, birgt gravierende Probleme und Gefahren.
Zustimmung kommt oft spät
Fälle, in denen Patienten trotz eingehender und nachdrücklicher Aufklärung aus freien Stücken eine Behandlung ablehnen, sind selten. Erfahrungsgemäß geben Patienten die Zustimmung auch zu Eingriffen, mit denen eine besondere körperliche oder psychische Belastung verbunden ist, oft erst nach längerer Zeit, sobald sie zum Arzt ausreichendes Vertrauen gefasst oder die Meinung eines anderen Experten eingeholt haben. Ob daher auf diesem Gebiet wirklich ein Regelungsbedarf besteht, erscheint zweifelhaft.
Auch angesichts des inhaltlichen Bestimmtheitserfordernisses, wonach nur eine konkrete Behandlung abgelehnt werden kann, stellt sich die Frage nach der praktischen Bedeutung dieses Instituts. Wohl nur in Ausnahmefällen (etwa dem Verbot einer Blutübertragung bei Anhängern der "Zeugen Jehovas") wird ein Patient eine bestimmte Maßnahme für sich als unerwünschten Eingriff prognostizieren können.
Unangenehmes wird verdrängt
Andererseits tendieren viele Patienten dazu, unangenehme medizinische Diagnosen zuerst zu verdrängen. Sie werden nicht schon nach dem ersten Aufklärungsgespräch in der Lage sein, die Tragweite des Verzichts auf eine Maßnahme richtig einzuschätzen. Eine Patientenverfügung, die in dieser Situation getroffen wird, wäre bedenklich. Häufig entwickeln Patienten die innere Bereitschaft, gegen eine bedrohliche Krankheit anzukämpfen, erst dann, wenn sie damit unmittelbar konfrontiert sind. Die vorgesehene Befristung auf fünf Jahre ist daher möglicherweise zu lange bemessen.
Weil die Patientenverfügung verbindlich ist, müsste der Arzt vor der Behandlung genau prüfen, ob ein Eingriff statthaft ist. Er dürfte die Verfügung selbst dann nicht ignorieren, wenn es um eine lebensrettende Maßnahme geht, deren Unterlassung zum Tod des Patienten führen könnte. Andererseits wäre auch die Unterlassung einer medizinisch indizierten und vom sorgeberechtigten Vertreter verlangten Behandlung pflichtwidrig, wenn ihr zwar eine Patientenverfügung entgegenzustehen scheint, diese sich aber bei genauerer Prüfung als ungültig erweist (z. B. wegen Irrtums oder ungenügender Aufklärung). Wie die ärztliche und klinische Praxis mit den erforderlichen juristischen Abwägungen zu Rande kommen soll, hätte sich zu weisen.
Ein ökonomisches Kalkül soll der Politik nicht unterstellt werden. Dass aber von dem im Gesundheitsbereich verschärften Kostendruck die Gefahr eines Missbrauchs ausgehen könnte, liegt auf der Hand. Für den Fall, dass Behandlungs-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen Druck zur Errichtung oder Unterlassung einer Patientenverfügung ausüben, sieht der Entwurf bloß Verwaltungsstrafen vor. Ob diese ausreichen, um einen Missbrauch zu unterbinden, sei dahingestellt.
Zu kritisieren ist schließlich, dass der Begriff der Patientenverfügung auf negative Verfügungen (Ablehnung einer Behandlung) beschränkt bleibt. Es mutet seltsam an, dass nur in dieser Richtung ein Schutzbedarf angenommen wird. Ausgehend von der Tatsache, dass jedem Menschen der natürliche Wille innewohnt, zur Rettung von Gesundheit und Leben Hilfe zu erhalten, erschiene es zumindest angebracht, festzuschreiben, dass die Zustimmung zu einer Behandlung vermutet wird, wenn eine Patientenverfügung fehlt oder unklar verfasst ist.
Autor:
Dr. Alexander Hofmann LL.M.
ist Rechtsanwalt in Wien.
www.hofmannlaw.at
ra-hofmann@aon.at
Quelle:
Die Presse, Rechtspanorama, 6. März 2006 / Seite 7
--------------------------------------------------------------------------------
STICHWORT: Patientenverfügungs-Gesetz
Patientenverfügung: Erklärung, eine bestimmte Behandlung abzulehnen, die bei mangelnder Einsichts-, Urteils- oder Äußerungsfähigkeit rechtswirksam ist.
Höchstpersö nliche Errichtung (z. B. nicht durch Sachwalter) in schriftlicher Form mit Datum, vor einem Rechtsanwalt, Notar oder rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretungen.
Prüfung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit und umfassende Aufklärung über die Folgen für die medizinische Behandlung durch einen Arzt.
Belehrung über Rechtsfolgen und Widerrufbarkeit durch den Rechtsbeistand.
Dokumentation der ärztlichen und juristischen Aufklärung.
Befristung auf maximal fünf Jahre; jederzeit widerrufbar.
Bei Missbrauch: Verwaltungsstrafen bis 50.000.
|